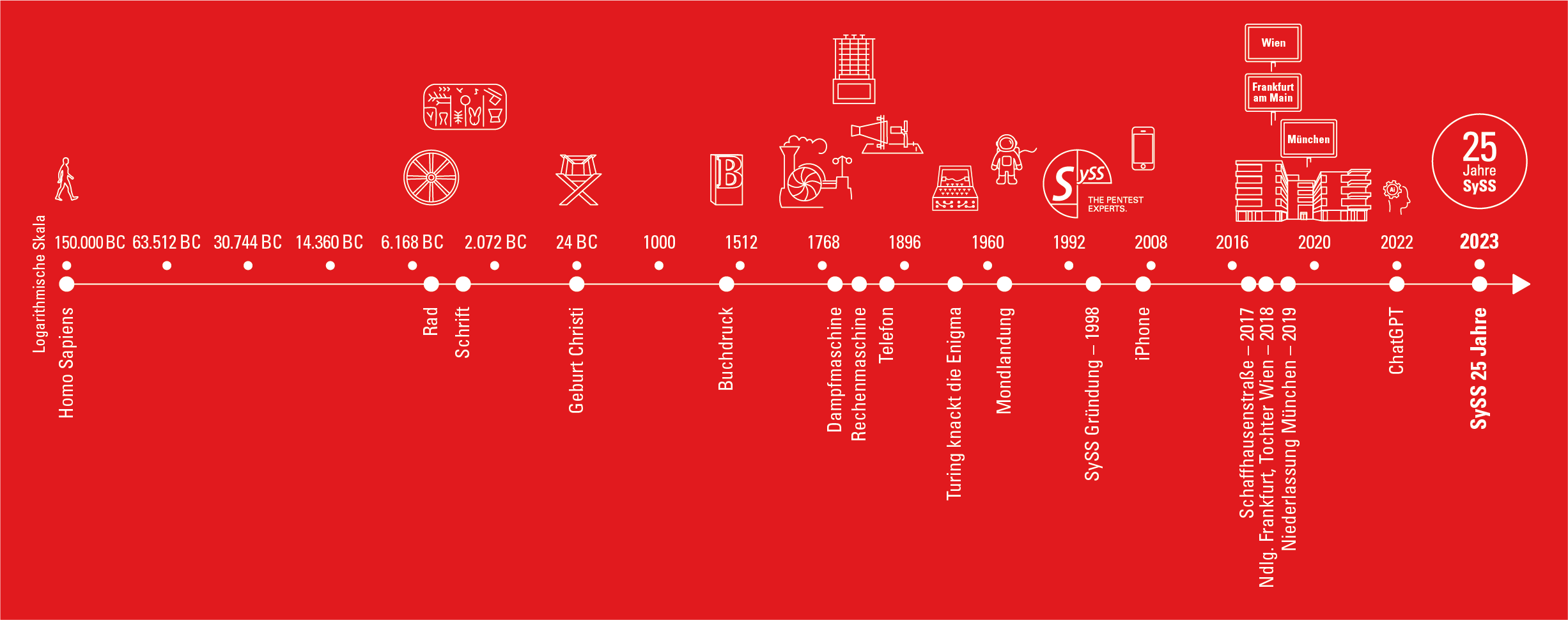- DE
- EN
Kindersicherheit im Netz: Gefahren vermeiden, Lernprozesse unterstützen
Sommerferienzeit – Zeit zu Surfen
Ein Secutorial von David Mändlen und Dr. Julia Kerscher

Es ist Sommerferienzeit. In einigen Bundesländern hat die Schule schon wieder begonnen, in anderen dauern die Ferien noch an. Viel Zeit, die Kinder und Jugendliche sonst in der Schule verbringen, verbrachten sie in den vergangenen Wochen zuhause oder bei außerschulischen Betreuungsangeboten. Schulferien bedeuten für Kinder und Jugendliche mehr Zeit, sich im Internet und in sozialen Medien zu bewegen. Mit erneutem Nachdruck stellt sich also die Frage: Wie können Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder im Netz sicher unterwegs sind?
Smartphone, Tablet, Laptop, …: Die Geräteklassen sind im Wandel, hinter die Technologie werden wir aber nicht mehr zurückkommen. Eine komplette Verweigerungshaltung, die Kindern und Jugendlichen grundsätzlich die Nutzung von Internet und sozialen Medien verbietet, ist insofern nicht zielführend, als der Umgang mit diesen Technologien gelernt sein will – und muss. Um Kinder bestmöglich in diesem Lernprozess zu unterstützen und sie vor Gefahren zu schützen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
Der technische Ansatz: Kinder-Sicherungen
Es ist die Technik selbst, die Verfahren der Kindersicherung anbietet, z.B. in Form von Standortbestimmungsapps. Solche Apps tracken die GPS-Koordinaten des Geräts, das das Kind dabeihat. Sie schreiben mit, was auf dem Gerät passiert, und bauen eine permanente Verbindung nach Hause auf. Das heißt: Eltern können live verfolgen, wo sich das Gerät gerade befindet, sie können sehen, wie lange es benutzt wird, welche Apps installiert sind usw. Dieses Verfahren ist einem MDM (Mobile Device Management) in Firmen vergleichbar und für den Notfall sehr hilfreich. Müssen Eltern schnell herausfinden, wo sich ihr Kind aufhält, ist eine Standortbestimmung Gold wert. Allerdings: Wer garantiert, dass die Apps sicher sind? Und vor allem: Wer garantiert, dass niemand Unbefugtes Zugriff auf die Bewegungsdaten der Jugendlichen hat? Sind es nämlich nicht die Eltern, die permanent mit Informationen zum Verbleib und zur Internetnutzung eines Kindes bzw. Jugendlichen versorgt werden, sondern eine unbekannte, dritte Person, kann die Standortbestimmung ganz entgegen ihrer Absicht schnell zur Gefahr werden.
Hinzu kommt: Wer möchte gern überwacht werden? Kaum jemand. Auch Kinder und Jugendliche nicht. Wird eine Spionage-App installiert, ist es – wie bei einem grundsätzlichen Handyverbot – nicht unwahrscheinlich, dass Kinder bzw. Jugendliche sich ein Ausweich-Device bzw. alternative Internetzugänge (z.B. öffentliche WLANs) organisieren und das elterliche Bemühen ins Leere läuft.
Nicht zuletzt: Auch wenn die subjektive Einschätzung von Eltern vielleicht eine andere ist, zumal da sie ihre Kinder schützen wollen: Auch Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Privatsphäre. Was im analogen Zeitalter das Tagebuch war, sind jetzt die App und der Chat. Ausspionieren ist tabu.
Kindersicherungen gibt es außerdem in Form von Altersbegrenzungen und damit zusammenhängenden Internetsperren. Ähnlich der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) bei Medien, bietet Google für Android-Telefone den Google Family Link an. Damit können Eltern Apps mit einem Jugendschutzfilter versehen, der im Play Store hinterlegt werden muss. Alle Apps, die keinen Jugendschutzhinweis haben, werden automatisch mit einer Freigabe ab 18 Jahren eingestuft und entsprechend für Kinder und Jugendliche im Play Store nicht angezeigt. Die Nutzung des Google Family Links unterliegt freilich einer Abwägungsfrage über zwei Varianten von Sicherheit: Eine solche Art Kindersicherung filtert Inhalte aus, die das Kindeswohl gefährden. Sie bedeutet aber auch, dass eine App die Kontrolle über das Gerät des Kindes besitzt. Und falls diese – etwa aufgrund eines Fehlers bei der Programmierung oder bei der Verwaltung der Daten – bei einem Hackerangriff verloren geht, ist der Hacker direkt auf dem Gerät des Kindes.
Keine Abwägungsfrage ist der Umgang mit Bezahlfunktionen. Hier ist der Rat klar: Mit dem Google- oder Apple-Account eines Kindes sollten keine Bezahlfunktionen verknüpft werden. Gerade sog. Microtransactions können zu erheblichen Problemen führen. Folgendes Szenario ist nicht unrealistisch: Ein Kind lädt sich ein kostenloses (im Play Store freigegebenes) Spiel herunter. Es kann in diesem Spiel extra Punkte machen, indem es etwas kauft. Das Kind klickt viele Male – und die Eltern erhalten eine hohe Rechnung. Wenn eine Bezahlfunktion hinterlegt ist und auf diese nicht verzichtet werden soll, muss sie unbedingt mit einem starken Passwort versehen werden, das nur die Eltern kennen und bei jedem Einkauf eingeben – oder den Einkauf eben unterbinden.
Grundsätzliche Verbote sind realitätsfremd und zukunftsblind, generelle Sperren erzielen häufig psychologisch eine entgegengesetzte Wirkung (Zensuren und Indices stellen nicht zuletzt geradezu eine Liste an ,interessanten‘ Gegenständen bereit). Der technische Ansatz unterliegt technischen Gefährdungen. Kindersicherheit im Netz ist zuallererst eine Frage der Medienkompetenz – und das heißt nicht zuletzt: eine Frage nach dem Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern sowie nach der Vorbildfunktion von Erwachsenen.
Der pädagogische Ansatz: (sich der) Kinder versichern
Kindern und Jugendlichen in Sachen Medienkompetenz ein Vorbild zu sein, ist für Erwachsene allein deshalb häufig nicht leicht, weil sie in der Regel den digitalen Raum, in dem Kinder leben, nicht kennen. Allein die Altersdifferenz und die unterschiedliche Sozialisation (die Mehrheit der heutigen Eltern sind, anders als ihre Kinder, keine Digital Natives) macht das Verstehen und die Einschätzung dessen, was Kinder da tun, schwer. Umso wichtiger ist es, sich mit der Welt von tiktok, Snapchat, Musical.ly usw. vertraut zu machen, und die Leidensbereitschaft aufzubringen, die es für Erwachsene zuweilen bedeutet, sich auf für Kinder und Jugendliche zugeschnittene Formate einzulassen. Nur wer die mediale Welt der jungen Generation kennt, kann sie beurteilen und deren Konsum sinnvoll lenken. So können Eltern beispielsweise ihren Kindern YouTube erlauben, unter der Voraussetzung, dass die Kinder die Kanäle, die sie schauen, dokumentieren (ab einem gewissen Alter regt dies auch zur Reflexion dessen an, was sie sich ansehen). Eltern haben so die Möglichkeit, Interesse an den Interessen der Kinder zu zeigen, gleichzeitig die Inhalte stichprobenhaft zu prüfen und transparent zu machen, weshalb sie bestimmten Content erlauben und anderen verbieten.
Eine nicht technisch forcierte Variante zur Spionage-App ist das Konzept der bekannten Passwörter: Den Kindern bzw. Jugendlichen wird ein freier Umgang mit Apps und Social Media eingeräumt, allerdings sind den Eltern alle Zugangsdaten und Passwörter bekannt und sie dürfen die Aktivitäten der Kinder im Zweifelsfall prüfen. Auch so kann stichprobenhaft die Mediennutzung evaluiert und bei Bedarf gesteuert werden. Sollte dem Kind etwas zustoßen (dies muss kein Kriminalverbrechen sein, es reicht ein Fahrradunfall), gibt es überdies evtl. eine Paper Trail. Eltern haben so ggf. die Möglichkeit, herauszufinden, wo das Kind für wann und mit wem verabredet war o.Ä.
Was Medienkonsum angeht, sind zwei Dimensionen zentral: Quantität und Qualität.
Die Frage nach der Quantität steht immer vor der Schwierigkeit, dass die medialen Angebote auf maximalen Konsum ausgerichtet sind. Wie viel Eigenverantwortung hier dem Kind überlassen werden kann, hängt vom Alter und den individuellen Kontrollfähigkeiten des Kindes ab. Bei kleineren Kindern ist es die Aufgabe der Eltern, den Blick darauf zu haben, wann die vereinbarte Zeit um ist. Grundsätzlich ist es schwer zu vermitteln, dass/warum jemand – seien dieser „jemand“ die Eltern oder andere Kinder – etwas darf, was dem Kind nicht erlaubt ist. Diskussionen darüber, dass „alle anderen Kinder“ ein Smartphone besitzen, bestimmte Apps nutzen dürfen oder tägliche lange Internetzeit haben, gewinnen z.B. durch Rückfragen im Elternkreis oder beim Elternabend an Kontur.
Die Frage nach der Qualität richtet sich darauf, wie Kinder und Jugendliche am besten davor zu schützen sind, dass sie schädliche Inhalte konsumieren. Was schädliche Inhalte sind, ist jedoch von Kind zu Kind verschieden. Eltern können es wagen, der Selbsteinschätzung der Kinder und Jugendlichen zu vertrauen, was sie schadlos vertragen. Eingegriffen werden muss, wenn deutlich wird, dass sie sich falsch einschätzen. Kindern vorzumachen, dass das, was auf Nachrichtenapps zu sehen ist, in der realen Welt nicht existiert, hat jedenfalls keinen Sinn. Irgendwann werden die Kinder damit in Berührung kommen; die Aufgabe der Eltern ist, sie verantwortungsvoll darauf vorzubereiten.
Medienkompetenz lässt sich aber auch ganz konkret trainieren: Gerade in der Ferienzeit bieten sich Urlaubsfotos an, um den datenschutzbewussten Umgang mit sozialen Medien zu üben. So kann z.B. das eigene Social Media-Profil aus der Perspektive von Fremden geprüft werden. Gemeinsam mit den Eltern sollten sich die Kinder fragen: Was ist nach außen sichtbar und was bedeutet das für mich? Soll auf Instagram durch das Urlaubsfoto deutlich werden, dass unsere Wohnung gerade leer steht? Will ich das Bild von mir mit herausgesteckter Zunge tatsächlich in den WhatsApp-Status stellen, sodass es auch meine Lehrerin sieht? Welche Einstellungen muss ich vornehmen, um diese Sichtbarkeiten einzuschränken? Oder entscheiden wir uns direkt für einen geschützten Familienchat? (Allgemein ist zu empfehlen, den Tausch von Bildern nur in einem geschlossenen Kreis und nicht im öffentlichen Internet vorzunehmen – wobei klar sein muss, dass im Falle von WhatsApp der geschlossene Kreis den Facebook-Server enthält.)
Medienkompetenz trainieren bedeutet auch, den Unterschied zwischen Konsummedien (das sprichwörtliche Sich-berieseln-lassen) und interaktiven Medien als Eltern produktiv zu nutzen. Interaktive Medien wie Chats oder Videospiele erfordern eine bestimmte Reife, weil sie gemeinsam mit einem medialen Gegenüber genutzt werden. Für Eltern bedeutet das, dass sie ihren Kindern auch für den digitalen Bereich Regeln des Miteinanders beibringen und deren Einhaltung sicherstellen müssen.
Der rechtliche Ansatz: Kinder vor Eltern, Eltern vor sich selbst schützen
Die meisten Eltern lieben ihre Kinder und sind stolz auf sie. Kinderbilder zieren die WhatsApp-Profile von Erwachsenen, Eltern posten die Namen und Bilder bzw. Videos ihrer Kinder auf Facebook, Instagram etc. Was viele dabei vergessen: Auch Kinder haben Persönlichkeitsrechte, sie haben ein Recht am eigenen Bild. Im Zweifelsfall können Kinder ihre Eltern erfolgreich – zumindest auf Unterlassung – verklagen, wenn ihre persönlichen Daten oder intime Bilder ohne ihr Einverständnis im Netz verbreitet werden. Zum Öffentlichmachen von Fotos beim Wickeln oder Baden ist – nicht nur zur Ferienzeit – zu sagen: Einfach bleiben lassen! Keine Diskussion.
Termine
17.04.2024
SySS bei den IT Security Talks der it-sa 365
17.04.2024
Awe1: IT-Sicherheit kennenlernen
18.04.2024
Awe3: Social Engineering Awareness
Ihr direkter Kontakt zu SySS +49 (0)7071 - 40 78 56-0 oder anfrage@syss.de | IN DRINGENDEN FÄLLEN AUSSERHALB DER GESCHÄFTSZEITEN +49 (0)7071 - 40 78 56-99
Als Rahmenvertragskunde wählen Sie bitte die bereitgestellte Rufbereitschaftsnummer
Ihr direkter Kontakt zu SySS +49 (0)7071 - 40 78 56-0 oder anfrage@syss.de
IN DRINGENDEN FÄLLEN AUSSERHALB DER GESCHÄFTSZEITEN +49 (0)7071 - 40 78 56-99
Als Rahmenvertragskunde wählen Sie bitte die bereitgestellte Rufbereitschaftsnummer
Direkter Kontakt
+49 (0)7071 - 40 78 56-0 oder anfrage@syss.de
IN DRINGENDEN FÄLLEN AUSSERHALB DER GESCHÄFTSZEITEN
+49 (0)7071 - 40 78 56-99
Als Rahmenvertragskunde wählen Sie bitte die bereitgestellte Rufbereitschaftsnummer